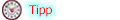|
Paul McCartney / The Love We Make
|
||
|
Oktober 2001, trüber Herbsttag, New York City, 45ste Straße. Der Verkehr staut sich moderat. Yellow Cabs schlängeln sich flink und gekonnt im ewigen Fluss ihrer legendären Unerreichbarkeit. Menschen eilen unbeirrten Blickes durch graue Häuserschluchten - Terminen entgegen, Zielen hinterher, ihren Leben davon? ... Plötzlich jedoch stoppt der Strom, stoppt die Uhr, stoppt der schier unerschütterliche Rhythmus der Top-of-the-world-Metropole - der zumindest westlichen Welt - für einen Moment. Es verirren sich die Blicke und fixieren sich auf ihn, der aus dem Nichts erscheint, im dezent-legeren Pullover, Hände in den Hosentaschen, andeutend lächelnd, doch offenen, wachen Auges, stets leicht tänzelnden Schrittes, umgeben von der Aura denkbar unauffälliger und zugleich ostentativer Erhabenheit.
»Oh my god!« schraubt die dunkelhaarige, temperamentvolle Mittvierzigerin ihre Stimme in ungeahnte Höhen: »This is Paul McCartney!« schwört sie dem ungläubigen Mann im Ohr ihres mobile phones und erstarrt zugleich in völliger Regungslosigkeit. Ein anderer Herr reicht Paul sein Handy. Er möge seiner Frau bitte bestätigen, dass er sie nicht auf den sprichwörtlichen Arm nimmt. »Yes, mam, this is Paul McCartney. I hand you over to your husband now. Thank you. Bye!« gebietet der Gentleman in britischer Höflichkeit. Ein glücklich Verzweifelter streckt dem wahrhaften Beatle seinen Reisepass entgegen und bittet um ein Autogramm. McCartney signiert zögerlich und scherzt: »Is this illegal?« Eine Frage, die ungeklärt bleibt.
Reihenweise schockt fabulous Paul New Yorker Passanten an diesem Tag, doch es gibt einen triftigen Grund, warum er hier ist. »Man muss etwas tun!« bekundet er seinen gegenwärtigen Aufenthalt im Big Apple, denn er bereitet gerade ein Großereignis vor, das als 'Concert for New York City' in die Geschichte eingehen soll. Anlässlich der Terroranschläge vom 11. September 2001, die McCartney vom New Yorker Flughafen aus in praktisch unmittelbarer Nähe miterlebte, stellt er eine Benefiz-Show der Superlative auf die Beine. Gewidmet ist sie vordergründig den New Yorker Feuerwehreinheiten, die ihren heldenhaften Dienst am Ort des beispiellosen Grauens schon seit mehreren Wochen leisten und geleistet haben.
»The love we take is the love we make« symbolisiert Paul McCartney sein Gefühl der Solidarität mit den Familien und Angehörigen der Opfer des wahnsinnigen Attentats, aber auch den New Yorkern selbst, denen er sich seit der glorreichen amerikanischen Beatles-Invasion im Jahre 1964 in besonderer Weise verbunden fühlt. Hautnah dabei war damals Albert Maysles, der das Filmmaterial für "What's Happening! - The Beatles In The USA" und "The Beatles - The First US Visit" lieferte. Wieder ist es Maysles, der nun für "The Love We Make" verantwortlich zeichnet und neben einem spektakulären 'Behind the Scenes'-Streifen ein intimes, authentisches Porträt des Paul McCartney zu skizzieren vermag.
Das extravagante Rockumentary stürzt sich ohne schwülstige Vorreden direkt in die Konzertvorbereitungen und begleitet McCartney auf den branchenüblichen PR-Turn-arounds, die der 'Man of the People' sowohl auf der Straße zwischen Menschen wie 'du und ich' als auch auf hochrangig angesetzten Pressekonferenzen in weltmännischer Nonchalance absolviert. Zu Terminen jeglicher Art fährt den Sir sein Chauffeur George. Dessen frappierende Ähnlichkeit zu George Martin verleiht dem privaten Geschehen hinter geschlossenen Autotüren nobler Bauart eine ungemein interessante wie unterhaltsame Note. Fahrer George muss schnell sein, über das letzte Yankees-Spiel Bericht erstatten, Anweisungen erahnen, Ruhe bewahren und geistesgegenwärtig reagieren, wenn sein Fahrgast spontanste Ideen ersinnt.
Wo Paul McCartney auftaucht, bildet sich grundsätzlich ein gepflegtes Chaos, das auf wundersame Weise eine innere Übersicht gewinnt, die Maysles in seiner brillant subtilen Kameraführung festzuhalten versteht. Er 'stellt' den Zuschauer genau dort hin, wo er stehen möchte, wenn sich Mac mit Ozzy Osbourne über dessen sehr frühe Karriere als Einbrecher und seine dafür präferierten fingerlosen Handschuhe unterhält, bevor Ozzy nur dank der Fab Four, wie er beteuert, doch noch den (fast) rechten Weg der rockenden Tugend einschlug. Man ist genau das Mäuschen, das man sein möchte, wenn Mac mit Eric Clapton in der Garderobe small-talked, über seinen neuen Song, den er eigens für das NY-Konzert geschrieben hat, fachsimpelt und freundschaftliche Kurz-Instruktionen für den gemeinsamen Part erteilt, den er sich G-Dur/E-Moll - alles »bluesy stuff« also, vorstellt. In blindem Einverständnis nicken die Professionals ab.
Der gebannte Zuhörer lauscht McCartneys Band-Proben, die entspannt, witzelnd, ungezwungen und gleichermaßen hochkonzentriert den Vorgaben des Meisters folgen. Der schüttelt zwischendurch mal eben ein grandioses, emotionales "From A Lover To A Friend" aus den eindrucksvoll geölten Stimmbändern und versierten Handgelenken ins Piano, löst die anschließende allgemeine Ergriffenheit mit einem pointierten »and now: relax!« ... Relaxed stellt sich der Sir ebenso den Anliegen lokaler Talk-Größen in Radio und Fernsehen. Selbst der an Stupidität nicht zu überbietenden Frage nach einer Beatles-Reunion begegnet der Routinier gelassen und erklärt bereitwillig: Es mache nun mal keinen Sinn, diese Band wiederzuvereinigen. Für ihn sei es einfach nicht möglich, auf die Bühne zu gehen und links neben ihm fehlt jemand. Jemand wie John.
Gedrückt hält man inne und realisiert in diesem Augenblick, dass nur einen Monat später schließlich George 'fehlen' würde ... Wie unbarmherzig die Zeit ihre Zeichen setzt, dokumentiert auch der letzte Auftritt von John Entwistle beim Concert for New York City, der die Who nur ein halbes Jahr später zu zweit zurücklassen wird.
Das Who-is-Who-Dropping im unmittelbaren Vorfeld des ausgesprochenen Mega-Events fesselt den Fan wie nahtlos aneinandergereihte Actionszenen in einem Tarantino-Thriller. McCartney trifft
Pete Townshend, der schwätzt über dies und das, beklagt Vergesslichkeiten im Alter infolge mutmaßlich übertriebenen »drug-abuses«. Brüderliche Küsse verteilt Elton John, der bedauert, der Aftershow-Party nicht beiwohnen zu können... anerkennendes Schulterklopfen von Billy Joel, dessen neues Klassik-Album Kumpel Paul grad wärmstens ans Herz legt, während Mick Jagger weiter hinten durchs Bild hüpft. Sheryl Crow fühlt sich sichtlich und wörtlich geehrt, McCartneys Wunsch ihrer stimmlichen Veredelung von "Let It Be" nachkommen zu dürfen. Halb Hollywood gibt sich ebenfalls die Ehre, in Gestalt von DiCaprio, Susan Sarandon, Jim Carrey oder Harrison Ford, der mit Paul höchst amüsant über den Grad wahren Ruhms sinniert. Unterdessen macht sich die Mac-Band locker, gibt sich cool und sympathisch zurückhaltend. Man verfolgt die Show bis zum eigenen finalen Auftritt backstage, spaßt mit Stella - Tochter McCartney, als Bill Clinton hereinschneit und den Shakehands-Herzlichkeiten von James Taylor Gesellschaft leistet. Der 'wilde' Bill schwärmt von träumerischen Teenager-Tagen, Segelabenteuern auf dem Atlantik und der seinerzeit liebstens vernommenen Musik des wasser- und feuererfahrenen Romantik-Spezialisten Taylor. Der wiederum deutet Paul seine bedingungslose Verehrung an, in dem er ihn bittet, um Gottes Willen nicht zuzuhören, wenn er gleich "Fire And Rain" zum Besten gibt. Denn das würde ihn so verunsichern, dass er sich garantiert verspielt.
Ganz in den Hintergrund treten die Schreckensbilder von Ground Zero, angesichts des bestgelaunten lebendig wandelnden Rock/Pop- und Celeb-Lexikons. Ein möglicherweise gewollter Effekt? Eine seltsam gespenstisch anmutende euphorisch optimistische Atmosphäre, wie sie das Giga-Konzert im Madison Square Garden wenig später selbst vermittelt? Etwas verstörend wirken sie schon, die Bilder toter Feuerwehrmänner, in die Kameras gehalten von Witwen und Waisen, und den weinend lachenden Bon Jovi-, David Bowie- oder Rolling Stones-Fans, die sie eben auch sind, an diesem Abend. Paul McCartney vergleicht Situationen des blanken Horrors wie die von 9/11 mit den Erlebnissen seiner Kindheit am Ende des Zweiten Weltkrieges. Tatsächlich, beschreibt er seine Erinnerungen, seien es Humor und Musik gewesen, die helfen konnten, traumatische Geschehnisse und unaussprechliche Trauer zu überwinden, um irgendwie weiter zu leben.
Billy Joel versprüht den glamourösen Charme seiner wortschlichten weltverlorenen Großstadt-Poesie und bringt auf den Punkt des Insiders, was ihn ausmacht, den unverwüstlichen, außergewöhnlichen Lebensgeist seiner Landsleute in Long Island, Manhattan und Brooklyn:
»It comes down to reality, and it's fine with me cause I've let it slide… I don't care if it's Chinatown or on Riverside… I don't have any reasons… I left them all behind… I'm in a New York state of mind...« Externe Links:
|