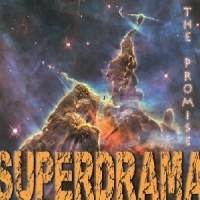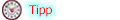|
Superdrama / The Promise
|
|||
|
Es mag wohl dem musikalisch gleichgeschalteten Siechtum und dem Entdeckerdrang einer nicht ausgestorbenen Hörerschaft geschuldet sein, dass der tönende Widerstand gegen Pop-Globalisierung sowie
akademisch profundes Musiziertum allen Kritikern zum Trotz ungebrochen
scheint.
Einst als krautige Egomanie verspottet, generierte das totgeglaubte Progrock-Genre auch hierzulande einen durchaus ernstzunehmenden Nachwuchs,
dessen nostalgisch beseelter und zum Eigenleben erwachsener Mehrwert
dereinst alle Befürchtungen um versagte Annerkennung entkräftete.
Nichtsdestotrotz üben die musikalischen Pioniertaten kunstbeflissener Laboristen nach wie vor ihren unbeugsamen Reiz, nicht nur im Mutterland, auf eifrige Erneuerer aus.
Somit ist es kaum verwunderlich, dass selbst von rheinischer Frohnatur und äpfelvergorenem Rebensaft trunkene Heimatregionen eben diesen süßen Verlockungen nicht zu widerstehen wussten.
Produzierten sich unsere Helden anfangs noch als Nachlass pflegende Prog-Hobbytheker und Übungsraum-Tüftler, so mauserten sich diese über die Jahre in künstlerischer Hinsicht zu gereiften und durchaus innovativen Recyclern vertrackter Rock-Derivate.
Wie alle Pop-Entdecker zuvor, suchte die 2004 vom Mainzer Lehrer sowie Musik-Allrounder Robert Gozon und dem trommelnden Kommunikations-Spezialisten Robert Stein-Holzheim begründete Tafelrunde nach dem Gral der stilistischen Erweiterung und mengenuntauglichen Virtuosität.
Die kreative Triebfeder des mittlerweile zur Quintettgröße gewachsenen Musikerkollektivs bildete weitaus mehr als die bloße Kunst, sich in endlos scheinende Gitarrenläufe und schwülstige Keyboardschwaden zu verstricken, sondern dem metaphysischen Ergründen unseres Daseins ein sowohl thematisch altkluges als auch eklektizistisches Arrangement maßzuschneidern.
Vermutlich bestärkt vom studentischen Faszinosum philosophierender Schöpfungs-Schwarten sowie angelsächsischen Rock-Schwurbeleien konstruierten die Wiesbadener vehement ihre Ikonen verehrenden Epen zwischen labyrinthischer Pointiertheit und großformatigen Flokati-Rhythmen.
Ihre sprichwörtlichen lyrisch dramatisierenden Gipfelstürme spiritueller Weisheiten und die nach eigener Aussage super-dramatische Erforschung »allen Seins auf der kosmischen Bühne« geleiten den Hörer durch ein klanglich üppiges Gefühlsuniversum.
In alter Konzeptalben-Manier sollte man das programmatische Superdrama-Debüt als eine Einheit konsumieren, mit den Texterklärungen in den Händen, um mit Robert Gozons deliziösem, bis zuweil manieriertem Vokal-Gewölk die quälendsten Fragen des Humanum genus zu erlösen.
Ganz im Sinne revolutionierender Vorgaben verstehen es die Protagonisten, bordürengeschmückte und den Siebzigern entbundene Tastenteppiche, verästelte Saitenkünsteleien nebst perkussiv-vertrackten und an den Festen des Artrocks rüttelnde Rhythmus-Korpusse als Retro-Verhaftete, jedoch kompositorisch eigenhandschriftlich zu konservieren.
Aus der menschlichsten aller Gemütslagen, der irdischen Sterblichkeit sowie dem Danach, haben diese auf "The Promise" nun ein handwerklich bemühtes, von endhippiebewegten und versponnenen Kunstrock-Gedächtniskosmen gespeistes Statement geformt.
Geradezu ehrfürchtig und ohne jedes Wagnis bahnbrechender Experimente verneigen sich vielschichtige Songkonstrukte wie "Turn The Stone" oder "Beyond The Edge", eine Halluzinogen-gedimmte und gleichwohl enigmatische Anleitung zum Ableben, vor dem sowohl Crimson'schen als auch Früh-Yesschen Tafelsilber.
Dass die teilweise unter erdigen Live-Bedingungen und dennoch klangästhetisch produzierten Arrangements trotz ihrer musikalischen Dichte keinesfalls überladen klingen, ist wohl den peniblen Fingerübungen und jenem zwischen kehligem Drang und mondänem Herzschmerz balancierenden Sanges-Testimonial geschuldet.
Superdrama halten über die gesamte Distanz ihr Versprechen und pflegen das schulmeisterliche Fluidum tüfteliger Rock-Propheten, bereiten mit "The Promise" dem tradionellen sowie von konservativer Hörerwartung abgezirkelten Musik-Format eine bekennende Lobby. Und so durchstreifen progistische Wechselbälger selbst im ausschweifenden Finale die musikalisch von Genre-nerdigen Veteranen favorisierten Flure und begraben die bedeutungsschwangeren Reisen durch unser Bewusstsein unter Hackettschen Saiten-Baldachinen, barocken Orgelthemen sowie reichlich verquastestem Synthie-Plüsch.
Im Nachgang empfiehlt sich dieses scheinbar aus der Zeit gefallene Opus für aufgeklärte Spätgeborene, tendenziell jedoch allen Rock-hörigen Reich-Ranickis mit einer Obsession nach Nostalgischem.
Und wer sich beeilt, bekommt das streng limitierte und 60 Seiten starke Mediabook gleich dazu.
Line-up:
Robert Gozon (vocals, keyboards) Robert Stein-Holzheim (drums) Michael Hahn (guitars) Thomas Klarmann (bass, flute) Thilo Brauß (organs)
Externe Links:
|