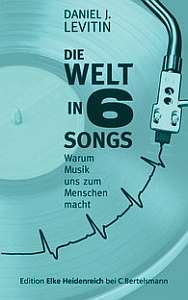|
Daniel J. Levitin / Die Welt in 6 Songs
|
||
|
"Die Welt in 6 Songs - Warum Musik uns zum Menschen macht" wenn ein solcher Titel einem Musikmagazin zum Besprechen angeboten wird, gehe ich zunächst davon aus, dass in diesem Buch sechs ganz besondere Lieder vorgestellt werden. Vielleicht hatte ich auch nur die falsche Vorstellung, denn DIE sechs Songs, die uns zum Menschen machen, sucht der geneigte Leser in Levitins Buch vergeblich.
Es geht in dem Buch schon um Musik, auch um besondere Lieder. Die Betrachtungsweise liegt aber nicht unbedingt auf dem Schwerpunkt, der vielleicht den leidenschaftlichen Musikfan mitreißt. Es sind keine Musikbesprechungen im herkömmlichen Sinn, sondern - tja, nun wird es ein bisschen komplizierter. Nach eigener Aussage versucht »Die Welt in 6 Songs sich an einer Erklärung der gemeinsamen Entwicklung von Musik und dem menschlichen Gehirn über Tausende von Jahren hinweg und auf allen fünf Kontinenten«. Ein hochgesetzter Anspruch, dem der Autor durch Exkursionen in die Neurobiologie, Musiktheorie und -geschichte, Evolutionstheorie, Psychologie, Biologie und noch etliche Fachgebiete mehr, gerecht wird. Daniel Levitin hat selbst Musik gemacht, Pop- und Rockplatten produziert und forscht heute über den Zusammenhang von Musik, Evolution und dem menschlichen Gehirn. Er hat genaugenommen sechs Typen von Musik ausfindig gemacht. Diese ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und werden von ihm definiert als Lieder zu den Themen:
Am Beispiel der Freundschaft schildert er zu Beginn zwei recht unterschiedliche Szenarien. Im ersten lässt er eine Gruppe Urmenschen auf dem Boden um das Feuer zusammengekauert schlafen und von trommelnden Angreifern bedroht werden. Diese haben durch größere kognitive Fähigkeiten erkannt, dass das Trommeln auf den Gegner demoralisierend wirkt und gleichzeitig den Zusammenhalt der eigenen Gruppe stärkt.
Im zweiten Szenario steht eine Gruppe von rauchenden Jugendlichen vor Unterrichtsbeginn hinter einer Highschool in Kansas City und hört auf dem krächzenden Ghettoblaster zusammen den Song "Smokin' In The Boys' Room" von Brownsville Station, ein Lied, das ihre Gruppe verbindet und zusammenhalten lässt. Gruppenzusammengehörigkeit ist bei den Liedern, die Levitin als Freundschaftslieder tituliert hat ein großes Thema, das leider nicht nur zur Verbindung untereinander, sondern auch häufig zur Verbündung gegen andere dient. Die extremste Ausprägung davon ist das Kriegsgeschrei, für das er auch biblische Zitate anführt. Endgültig zur Perversion geführt, dient der Gesang dazu, das gemeinsame Marschieren von Soldaten zu synchronisieren. Die Entstehung dieser Gesänge führt Levitin wieder auf die Primaten zurück, und schlussfolgert, dass »synchronisierte, koordinierte Gesänge und Bewegungen« als Bindeglied fungierten und so die Entstehung von Gesellschaften möglich machten. Er begründet dies evolutionsbiologisch und mit den neurochemischen Prozessen, die beim gemeinsamen Singen und Tanzen stattfinden, Darüber hinaus führt er eigene aktuelle Experimente zu diesen Mechanismen an. Neben Krieg und Jagd erkennt er auch gemeinsam durchgeführte Arbeiten als klassisches Feld für diese koordinierende Musik. Ob nun der Pyramidenbau im alten Ägypten oder Rudermannschaften, Musik macht er als organisierendes Element aus. Als weitere Lieder dieser Freundschaftskategorie führt er Musik an, die Solidarität entstehen lässt, beispielsweise Lou Reeds "Walk On The Wild Side" als 'Schwulenhymne', "My Generation" von den den Who als Ausdruck des Lebensgefühls einer damals jungen Generation oder Springsteens "Working On The Highway", das Arbeiter miteinander verband. Auch Protestsongs, wie
Bob Marleys "Get Up, Stand Up", John Lennons "Give Peace A Chance" oder "War (What Is It Good For?)" (ursprünglich von Edwin Starr, später von Größen wie Springsteen oder Frankie Goes To Hollywood gecovert) zählt er dazu. Über die Protestsongs schlägt der Schreiber dann noch einen Bogen zu Musik und Drogen, die sich in ihrer Wirkung verstärken, bevor er mit John Lennons Bed-In das Kapitel Freundschaft beendet. Auch die anderen Kategorien werden ähnlich weitreichend betrachtet und ausgeführt. Dabei bleibt Levitin aber gut verständlich und angenehm lesbar. Externe Links:
|